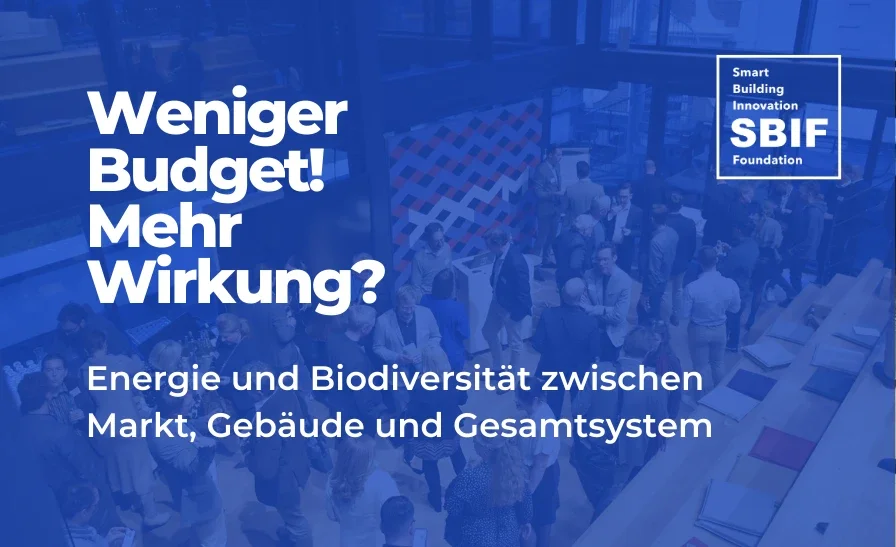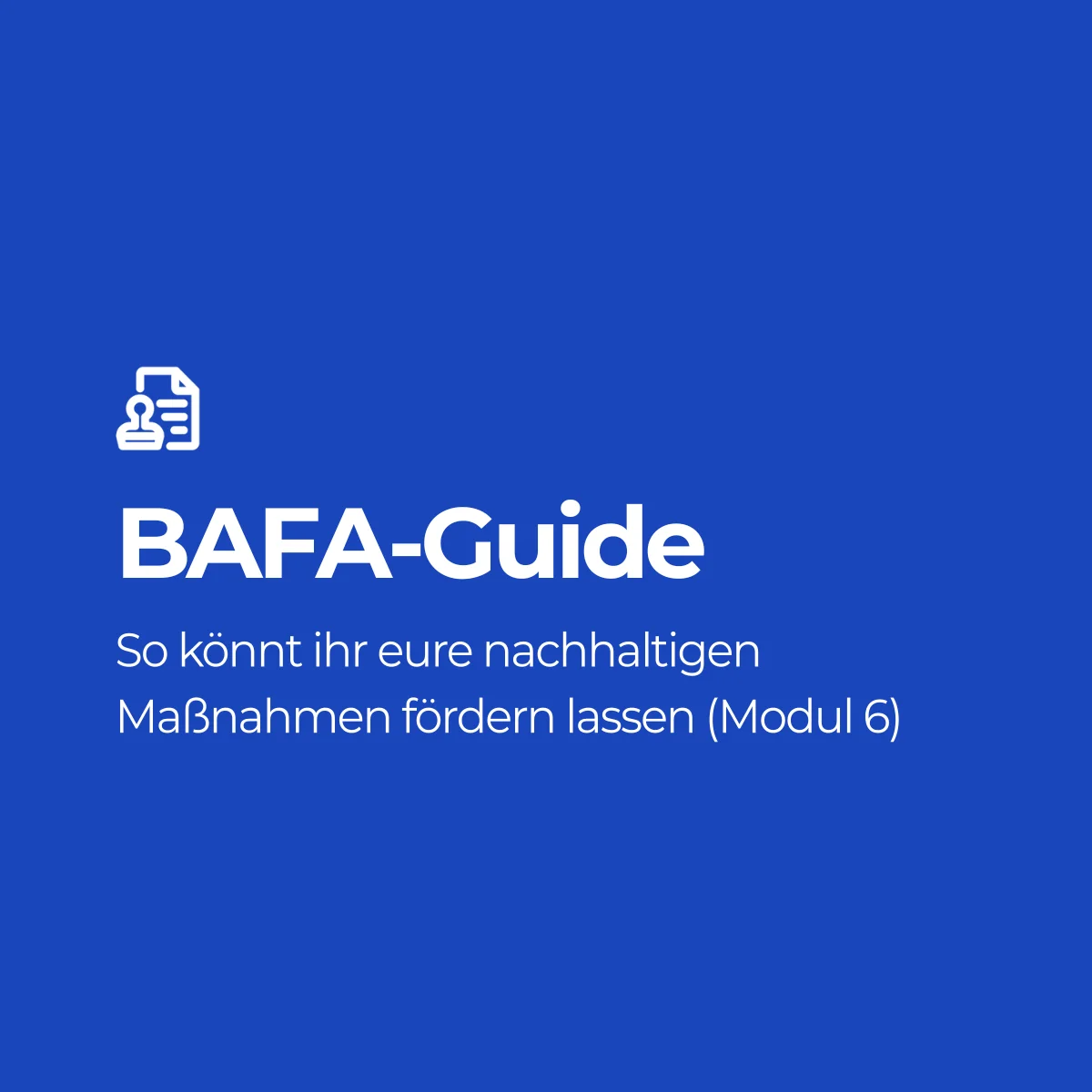Energieflexibilisierung im Gebäudebestand: Status Quo von Forschung und Praxis

Wie können Immobilien so betrieben werden, dass der Energieverbrauch flexibel auf aktuelle Preise, Netzanforderungen und die CO2-Intensität des gegenwärtig erzeugten Stroms reagieren können – ohne Komforteinbußen für die Nutzenden?
Im Rahmen unseres Innovationsworkshops am 26. März 2025 am Forschungszentrum Informatik (FZI) in Karlsruhe haben wir gemeinsam mit den Teilnehmenden konkrete Maßnahmen identifiziert, mit denen die Energieflexibilisierung im Gebäudebestand umgesetzt werden kann.
Wirtschaftliche Hebel der Flexibilisierung
Die wirtschaftlichen Dimension stand im Zentrum unserer Betrachtung. Abhängig von Größe und Struktur des Energieabnehmers bieten sich drei Modelle an:
- Dynamische Stromtarife: Ermöglichen Nutzenden, ihren Stromverbrauch gezielt in Zeiten mit niedrigen Preisen zu verlagern. Entsprechende Angebote sind mittlerweile am Markt verfügbar.
- Teilnahme am Regelenergiemarkt: Eröffnet Großabnehmenden die Möglichkeit, kurzfristig Flexibilität bereitzustellen. Kleinere Abnehmende könnten theoretisch über sogenannte Aggregatoren eingebunden werden. Dieses Modell ist jedoch bislang noch wenig verbreitet.
- Frühzeitiger Stromeinkauf an der Strombörse: Kann helfen, Preisschwankungen frühzeitig zu erkennen und strategisch zu nutzen. Potentiale zur Lastverschiebung erleichtern es dabei, Verbrauchsspitzen zu reduzieren und innerhalb der günstig vorab beschafften Strommengen zu bleiben bzw. den kurzfristigen Zukauf zu reduzieren.
Für die meisten Immobilien eignen sich aufgrund des vergleichsweise moderaten Verbrauchs dynamische Stromtarife besonders gut als Einstieg in eine flexible Energienutzung.
Technische Voraussetzungen im Gebäude
Damit flexible Stromnutzung im Gebäude erfolgreich umgesetzt werden kann, braucht es einige technische Grundlagen. Dazu zählt zunächst das Smart Metering: Neben wettbewerblichen Messstellenbetreibenden bieten mittlerweile auch viele Energieversorgungsunternehmen intelligente Stromzähler zu fairen Konditionen an.
Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Datenintegration. Spezialisierte Anbietende im Bereich Gebäudedigitalisierung können dabei unterstützen, Verbrauchs- und Anlagendaten zu erfassen, nutzungs- und gebäudespezifische Verbrauchsprognosen zu erstellen sowie Erzeugungs- und Preisprognosen von Energieanbietenden zu nutzen. Auf dieser Basis entwickeln sie automatisierte Anlagenfahrpläne. Das Ziel: Den Energieverbrauch flexibel an Marktbedingungen und tatsächlichen Bedarf anzupassen.
Flexibilisierung durch Nutzendenbeteiligung
Die aktive Beteiligung von Nutzenden an der Flexibilisierung des Stromverbrauchs ist nicht immer leicht – beispielsweise sind die Interessen unterschiedlich. Gleichzeitig kann sie einen wichtigen Beitrag leisten, wenn sie gut gestaltet ist. Drei Faktoren sind dabei besonders hilfreich:
- Transparenz: Eine intuitive Visualisierung, z. B. eine „Stromampel“, macht günstige und ungünstige Zeitfenster leicht erkennbar.
- Einfachheit: Informationen sollten möglichst kurz, klar und visuell verständlich aufbereitet sein. Zeit ist knapp und das Interesse nicht immer groß.
- Rückmeldung zum Einfluss: Wer weiß, welchen Unterschied das eigene Verhalten macht, ist eher bereit, mitzumachen. Hilfreich sind Antworten auf Fragen wie: „Wie hoch ist mein aktueller Stromverbrauch oder CO₂-Ausstoß?“, „Was kann ich direkt beeinflussen und wie?“ oder: „Bemühen sich auch andere, z. B. das Betriebspersonal?“
E-Mobilität als Bestandteil des Energiesystems
Elektromobilität wird zunehmend integraler Bestandteil des Energieökosystems. Für Immobilien mit Ladeinfrastruktur eröffnet das neue Potenziale – vor allem im Hinblick auf Flexibilität und Netzdienlichkeit:
- Dynamisches Lade- und Lastmanagement erlaubt es, Ladevorgänge intelligent an die Gebäudelast anzupassen und Lastspitzen gezielt zu kappen (Peak Shaving). Dadurch lassen sich Netzentgelte senken. Technisch ist dieses Modell etabliert und am Markt bereits breit verfügbar.
- Smart Charging, also das intelligente Laden auf Basis individueller Wünsche der Nutzenden wie Abfahrtszeit oder gewünschtem Ladeziel, ermöglicht eine bedarfsorientierte Steuerung. Die Umsetzung ist technisch möglich, in der Praxis jedoch noch eingeschränkt, da passende Anbietende aktuell schwer zu finden sind.
- Bidirektionales Laden bietet langfristig das größte Potenzial: Elektrofahrzeuge können nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch abgeben, z. B. als Zwischenspeicher für selbst erzeugten Strom oder zur Netzstützung in Hochlastzeiten. Erste Prototypen und Demonstratoren existieren bereits.
Flexibilität von Heizungs-, Kälte- und Lüftungsanlagen
In größeren Gebäuden sind Heizungs-, Kälte- und Lüftungsanlagen in der Regel automatisiert und so ausgelegt, dass sie im Teillastbetrieb arbeiten – häufig mithilfe von Wärme- oder Kältespeichern, um zu kurze Taktzeiten zu vermeiden. Damit sind bereits wichtige technische Grundlagen für einen flexiblen Betrieb vorhanden.
Grundvoraussetzung für eine intelligente Steuerung ist eine funktionierende Anlagenautomation. Ergänzt wird diese idealerweise durch Wärme-, Kälte- oder Batteriespeicher, die als Puffer dienen können. Besonders relevant für die flexible Stromnutzung sind zudem Komponenten der Sektorkopplung: Wärmepumpen und Kompressionskältemaschinen gehören in vielen Gebäuden zu den größten Stromverbrauchern und bieten damit erhebliches Potenzial für eine netzdienliche Betriebsweise.
Informationsbedarf bei Planung und Bewertung
Trotz zunehmender technischer Möglichkeiten besteht weiterhin ein deutlicher Informationsbedarf – insbesondere, wenn es darum geht, die Wirtschaftlichkeit flexibler Betriebsweisen grob abzuschätzen. Derzeit fehlen verlässliche Kennzahlen, um die wichtigsten Einflussgrößen sinnvoll zu bewerten. Dazu zählen unter anderem:
- die CO₂-Intensität dynamischer Stromtarife,
- die Nutzungsart und -zeiten des Gebäudes (z. B. durchgängiger Betrieb oder Wochenbetrieb) der Einfluss flexibler Flächennutzung (z. B. durch wechselnde Belegung oder temporäre Absenkung einzelner Bereiche),- die thermische Trägheit des Gebäudes,- sowie die Art und Auslegung der technischen Ausstattung wie Heizung, Kühlung und Lüftung.
- der Einfluss flexibler Flächennutzung (z. B. durch wechselnde Belegung oder temporäre Absenkung einzelner Bereiche), die thermische Trägheit des Gebäudes sowie die Art und Auslegung der technischen Ausstattung wie Heizung, Kühlung und Lüftung.
Perspektiven für den Gebäudebetrieb
Die Möglichkeiten, Energie flexibel zu nutzen und vorhandene Speicher netzdienlich einzubinden, nehmen stetig zu. Gleichzeitig wird es einfacher, von der eigenen Lastflexibilität wirtschaftlich zu profitieren. Der Innovationsworkshop hat uns gezeigt: Viele Maßnahmen sind bereits heute sowohl technisch umsetzbar als auch wirtschaftlich sinnvoll – insbesondere dann, wenn Flexibilität von Anfang an als integraler Bestandteil der Gebäudeplanung oder -sanierung mitgedacht wird.
Ihr wollt wissen, wie das in der Praxis aussehen kann? Bald zeigen wir euch hier im Blog konkrete Lösungen und Anbietende.