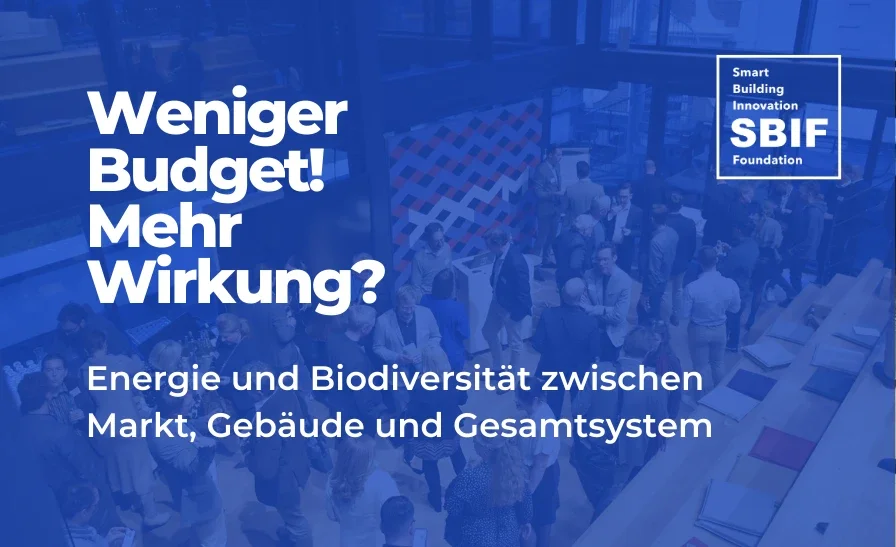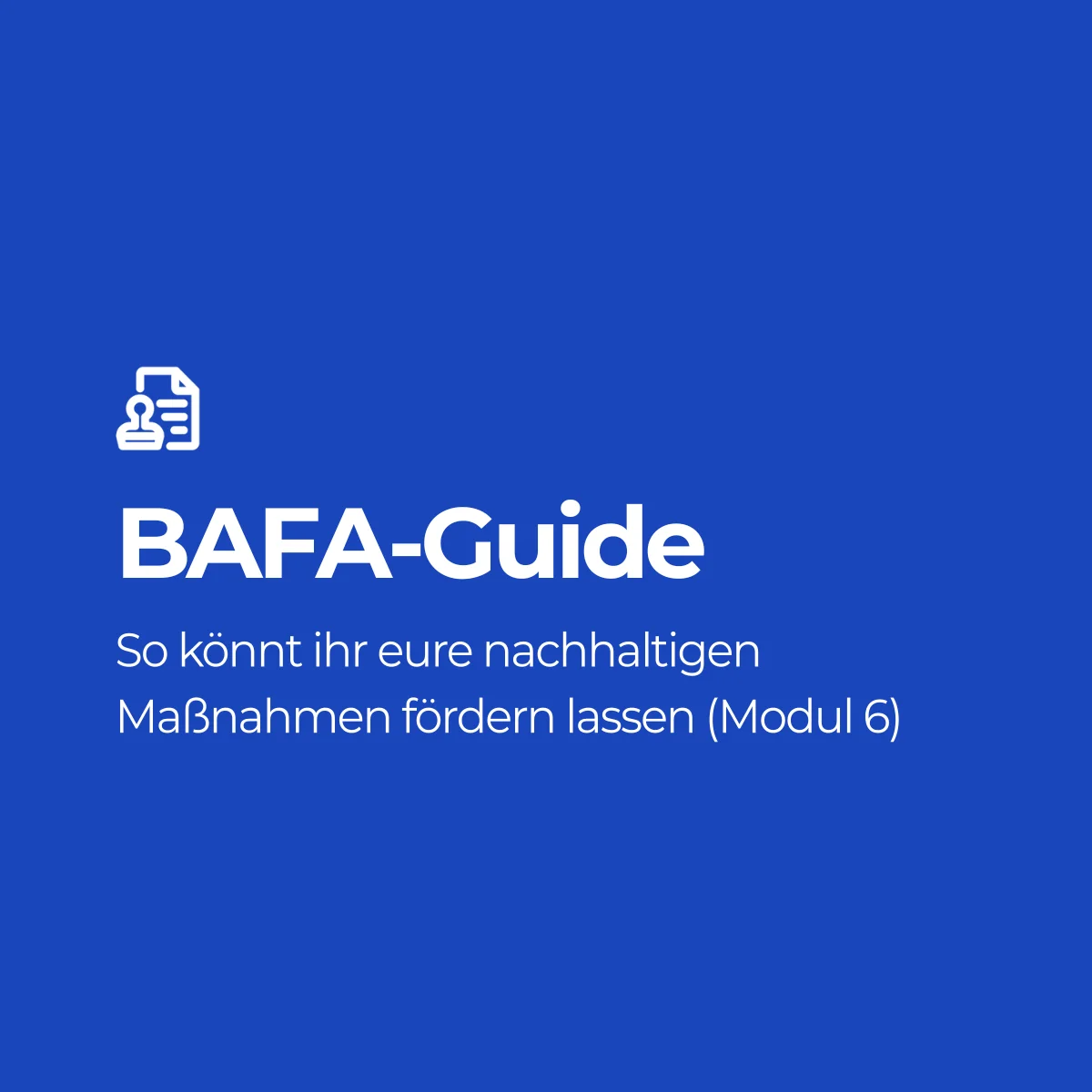KI im Gebäudebetrieb: Zwischen Vision und Wirklichkeit

Künstliche Intelligenz ist überall. Täglich neue Schlagzeilen, Videos und große Versprechen. In unserer Branche führt das schnell zum Bild vom vollautonomen Smart Building, das mit Nutzenden interagiert, Probleme löst und Abrechnungen automatisch erstellt. Ist das realistisch?
Die Wirklichkeit ist bodenständiger: KI wird den Gebäudebetrieb verändern, aber nicht abrupt und auch nicht linear. Tempo und Tiefe hängen vor allem von zwei Dingen ab: Datenqualität und Akzeptanz. Vor diesem Hintergrund lassen sich vier Phasen erkennen – manche laufen parallel, andere bauen aufeinander auf.
Diese Prognose spiegelt die Perspektive der SBIF wider. Sie beruht auf Erfahrungen aus dem Gebäudebetrieb und Beobachtungen vergangener Technologietrends. Bitte lest den Text so, als stünde vor jeder Aussage ein könnte, vermutlich oder vielleicht.
Phase 1: KI als unsichtbare Hilfe
Die ersten konkreten Anwendungen von KI im Gebäudebetrieb sind kaum sichtbar. Statt spektakulärer „sprechender Gebäude“ geht es um stille, aber wertvolle Verbesserungen im Hintergrund. KI kann beispielsweise Teams im Facility Management (FM) unterstützen, indem sie Routineaufgaben übernimmt und Entscheidungen vorbereitet.
Ein typisches Beispiel ist das Vorsortieren von Service‑Tickets. Anfragen landen nicht mehr ungefiltert beim Betrieb, sondern werden von der KI bewertet, verschlagwortet und mit Antwortvorschlägen versehen. FM‑Fachkräfte prüfen und geben frei – wenige Klicks statt viel Tipparbeit. Außerdem optimiert KI die TGA, etwa indem Vorlauftemperaturen dynamisch an Außentemperatur und Bedarf angepasst werden.
Der Nutzen liegt auf der Hand: effizientere Prozesse, entlastete Mitarbeitende. Gleichzeitig zeigt sich hier das Kernproblem: Viele Bestandsgebäude haben zu wenig oder zu unzuverlässige Daten. KI ist auf Input angewiesen. Genau hier befinden wir uns heute. Erste Pilotanwendungen liefern messbare Vorteile und zeigen das Potenzial. Zugleich wird klar: Ohne bessere Datenbasis und mehr digitale Durchdringung bleibt es bei Leuchttürmen.
Phase 2: KI wird zur Ansprechperson
In der zweiten Phase tritt KI aus dem Hintergrund heraus und rückt näher an die Gebäudenutzenden. Sie wird zur ersten Anlaufstelle bei Unannehmlichkeiten oder Problemen. Ein Beispiel: Jemand empfindet die Raumtemperatur als zu hoch. Die KI nimmt die Meldung entgegen, prüft die vorliegenden Daten und gibt eine sofortige Rückmeldung – etwa, dass die Außentemperatur gerade stark gestiegen ist und eine Anpassung eingeleitet wurde.
Ähnlich funktioniert es bei einer WC-Leckage: Eine betroffene Person meldet das Problem direkt an die KI. Diese erfasst die Störung, informiert sofort das Facility Management und leitet die notwendigen Schritte ein. Auf Wunsch hält die KI die Nutzenden über den Status auf dem Laufenden – dabei entscheidet das Facility Management, welche Informationen weitergegeben werden und welche intern bleiben.
Für FM‑Dienstleistende verschiebt sich das Profil: Faktoren wie menschliche Kommunikation, Problemlösung, Priorisierung werden wichtiger, während Standardfälle zunehmend digital abgewickelt werden. Für Betreibende bedeutet das: kürzere Reaktionszeiten, transparentere Prozesse, zufriedene Nutzende.
Phase 3: Teilautonome Prozesse im Betrieb
Mit der dritten Phase erreicht KI den Kern des Gebäudebetriebs. Routineaufgaben werden nicht mehr nur vorbereitet, sondern zunehmend eigenständig ausgeführt. Energiemanagement, die Optimierung von Betriebszeiten oder das automatische Lastmanagement sind Bereiche, in denen KI bereits heute Potenzial zeigt. Standardwartungen könnten ebenfalls durch KI vorgeschlagen, dokumentiert und teilweise direkt initiiert werden.
Allerdings bleiben hier klare Grenzen. Regulatorische Vorgaben etwa im Brandschutz oder bei sicherheitsrelevanten Anlagen verhindern, dass KI vollständig autonom agiert. Auch die Verantwortung der Betreibenden darf nicht unterschätzt werden: Am Ende müssen Menschen Entscheidungen nachvollziehen und Freigaben erteilen können. Phase 3 bedeutet deshalb nicht das Ende menschlicher Kontrolle, sondern vielmehr eine Verschiebung der Rollen. Menschen konzentrieren sich auf komplexe Fälle und strategische Entscheidungen, während KI repetitive Prozesse übernimmt.
Phase 4: Vision des vollautonomen Gebäudebetriebs
Ob und wann wir die vierte Phase erreichen, ist offen. Hier beginnt die Vision des vollautonomen Gebäudebetriebs. In diesem Szenario übernehmen KI-Agenten nicht nur die Steuerung technischer Anlagen, sondern auch finanzielle und organisatorische Prozesse. Rechnungen werden automatisch ausgelöst, sobald ein Zählerstand oder eine Wartungsbestätigung vorliegt.
Mietverträge und Zahlungen könnten vollständig automatisiert abgewickelt werden, ganz ohne administrativen Aufwand. Technisch denkbar ist auch, dass die Auswahl der Mietenden sowie die Bonitätsprüfung weitgehend automatisiert erfolgen. Das Gebäude „entscheidet“ dann selbst, wer es nutzen darf, wie die Abrechnung funktioniert und wie Betrieb und Instandhaltung optimiert werden. Ob dies über Blockchain, Smart Contracts oder andere Technologien geschieht, ist zweitrangig – entscheidend wäre das Prinzip der durchgängigen Automatisierung.
Doch so reizvoll dieses Bild ist: Es bleibt Zukunftsmusik. Gesellschaftliche Akzeptanz, regulatorische Rahmenbedingungen und ethische Fragen setzen enge Grenzen. Klar ist nur: Ohne positive Erfahrungen in den vorangegangenen Phasen wird diese Vision nicht Realität.
Was alle Phasen verbindet: Datenqualität, Akzeptanz & Rolle des Menschen
Unabhängig von der jeweiligen Stufe bleibt eine Konstante: Ohne saubere Daten keine wirksame KI. Betreibende von Gebäuden, die heute noch mit fragmentierten Excel-Tabellen und falschen Sensorwerten arbeiten, werden den Mehrwert von KI kaum nutzen können. Genauso entscheidend ist die Akzeptanz bei Betreibenden und Nutzeden. Vertrauen entsteht nicht durch Marketing, sondern durch positive Erfahrungen im Alltag: schnelleres Feedback, geringere Kosten, besseres Raumklima. Jede erfolgreiche Anwendung ist ein Schritt, um Skepsis abzubauen.
Und schließlich die Rolle des Menschen: KI ersetzt nicht die Expertise, sondern verschiebt ihren Schwerpunkt. Facility Manager und Betreibende werden weniger Zeit mit Routineaufgaben verbringen und stärker zu Gestalter*innen von Prozessen, Coaches für die Zusammenarbeit mit KI und Entscheidungstragenden in kritischen Situationen. Empathie, Kreativität und Erfahrung bleiben unersetzbar.
Fazit: Das können Betreibende, Eigentümer*innen und Herstellende heute tun
Der Weg zu mehr KI im Gebäudebetrieb ist kein Sprung, sondern ein Prozess. Wer heute noch abwartet, verschenkt wertvolle Zeit. Denn schon jetzt können Betreibende, Eigentümer*innen und Herstellende die Grundlagen legen:
- Daten erfassen und strukturieren: Ohne verlässliche Sensorik, digitale Dokumentation und klare Schnittstellen bleibt KI ein leeres Versprechen.
- Pilotprojekte starten: Kleine, risikoarme Anwendungen im Facility Management schaffen erste Erfahrungen und erhöhen die Akzeptanz.
- Kompetenzen aufbauen: Mitarbeitende müssen lernen, mit KI-gestützten Systemen umzugehen, Ergebnisse zu interpretieren und die Technik sinnvoll einzusetzen.
- Kooperationen suchen: Die besten Ergebnisse entstehen dort, wo Betreibende, Herstellende und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, um Standards zu entwickeln und Wissen zu teilen.
Ob wir eines Tages tatsächlich vollautonome Gebäude erleben, ist ungewiss. Sicher ist aber: Wer heute investiert, experimentiert und Erfahrungen sammelt, wird morgen von den Chancen profitieren. Und weil Zusammenarbeit entscheidend ist, engagieren sich immer mehr Akteure in Netzwerken wie der SBIF, die als Plattform für Austausch, Innovation und Praxisprojekte dient. Nicht als Selbstzweck, sondern um die Branche gemeinsam voranzubringen – Schritt für Schritt.
Du möchtest Teil der SBIF werden?
Dann kontaktiert uns gerne, um über eine potentielle Zusammenarbeit zu sprechen.
Smart Building Innovation gGmbH
connect@sbif.foundation
+49 170 66 37 964
c/o KVL Bauconsult GmbH
Spichernstraße 2
10777 Berlin